Hinweis: Die Vorträge der Referenten stehen am Ende des Textes zum Download.
Den gesamten Beitrag finden Sie hier als PDF-Datei.
Zum Videomitschnitt der Veranstaltung geht es hier!
Details unter www.optimedis.de/berlineraufruf.
Diskrepanz zwischen Input und Outcome im Gesundheitswesen
Das deutsche Gesundheitssystem gilt weltweit als eines der besseren. Tatsächlich bescheinigt die OECD der Bundesrepublik in ihrem jüngsten Report „Health at a Glance“ eine hohe Versorgungsdichte: Auf 1.000 Einwohner kommen 4,3 Ärzte (Platz 5) und 13 Pflegekräfte (Platz 5 bzw. Platz 2 in der Europäischen Union). Bei den Krankenhausbetten ist Deutschland mit 8 auf 1.000 sogar Spitzenreiter. Doch, obwohl Deutschland 11,7 Prozent seines Bruttoinlandproduktes ins Gesundheitssystem steckt – nur die USA und die Schweiz geben noch mehr aus –, belegt es bei der Lebenserwartung mit 81 Jahren nur den 17. Platz und ist damit EU-Durchschnitt. Zudem werden die Menschen in Deutschland kränker alt als beispielsweise in Schweden: 65 Jahre alte Frauen haben im Schnitt 12,2 Jahre ohne gesundheitliche Einschränkungen vor sich. Gleichaltrige Schwedinnen können sich über weitere 15,8 gesunde Jahre freuen. Bei Männern sieht es ganz ähnlich aus. Darüber hinaus ist bei einigen Krankheiten, etwa bei Diabetes-Typ-2 oder der Koronaren Herzkrankheit, die Sterblichkeit in Deutschland höher als anderswo.
Die Gründe für die Diskrepanz zwischen Input und Outcome des Gesundheitswesens waren bei der Plenumsveranstaltung der B. Braun Stiftung und der OptiMedis AG am 28. Oktober 2021 schnell ausgemacht: Zum einen setzten die Vergütungsstrukturen falsche Anreize, indem sie sich an den Fallzahlen erbrachter medizinischer Leistungen ausrichten statt an ihrer Qualität. Zum anderen würden die Potenziale der Digitalisierung nicht ausgeschöpft. Zwar lägen Versorgungsdaten in ausreichender Menge vor, doch weder könne auf sie zugegriffen werden noch würden sie in die Qualitätsbewertung medizinischer Leistungen ausreichend einfließen. 70 Akteure aus dem Gesundheitswesen nahmen vor Ort im Langenbeck-Virchow-Haus in Berlin teil; 85 weitere verfolgten die Vorträge und Diskussionen über das Internet.

„Solange wir Anreize setzen, die sich an der Menge orientieren, laufen wir in die falsche Richtung“, stellte Dr. h.c. Helmut Hildebrandt fest, Vorstandsvorsitzender der OptiMedis AG. Angesichts des demografischen Wandels sei mit einer völlig neuen Morbiditäts- und Belastungsstruktur zu rechnen. Reformen müssten sich vor allem am Nutzen für Patienten orientieren, betonte Professor Dr. Alexander Schachtrupp, Geschäftsführer der B. Braun Stiftung. „Gemeinsam wollen wir erreichen, dass alle Akteure im Gesundheitswesen inklusive der Kostenträger diesen Nutzen auch nachweisen müssen.“ Es müssten Indikatoren entwickelt werden, die für die Patienten relevante und möglichst aggregierte Outcomes widerspiegeln, ergänzte Schachtrupp. Außerdem sollten auch die Betroffenen selbst ihre Erfahrungen und Präferenzen in einer national standardisierten Form einbringen können.
Diese Forderungen flossen ein in den „Berliner Aufruf für mehr Patientennutzen im Gesundheitswesen“, den die Veranstalter am Ende der Veranstaltung verabschiedeten. Sie wenden sich damit an die Gesundheitspolitiker der neuen Legislatur, um ihnen eine wichtige Stoßrichtung aufzuzeigen. Der Aufruf ist online zu finden unter www.optimedis.de/berlineraufruf. Weitere Akteure können sich ihm dort anschließen, die Liste der Unterzeichnenden wird fortlaufend aktualisiert.
Von „Volume“ zu „Value“
Namhafte Experten untermauerten die Forderung nach mehr Patientennutzen mit Hintergründen und Fakten. Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen an der Fakultät Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin, legte dar, wie Deutschland weg vom „volume“ im Gesundheitswesen hin zu mehr „Value“ kommen könnte. Das Volumen ist beträchtlich: An einem Tag finden 3 Millionen Arzt-Patienten-Kontakte statt, gehen 2 Millionen Medikamentenpackungen auf Rezept über den Tresen, liegen 380.000 Menschen im Krankenhaus – „eine Stadt von der Größe Bochums“, so Busse. Täglich werden 50.000 Patienten neu stationär aufgenommen. Zudem sitzen täglich 50.000 Menschen in der Notaufnahme.
Abgesehen von den USA und der Schweiz gibt kein anderes Land der OECD mehr Geld für medizinische Leistungen aus. Die Begründung lautet häufig: hohe Fallzahlen. Doch die Wahrheit sieht laut Busse ganz anders aus: Nicht der Gesundheitszustand der Deutschen mache die vielen Krankenhausbetten erforderlich, sagt der Wissenschaftler, sondern die vielen Betten sorgten für viele Fälle. Deshalb stehe der „Value“ – der Nutzen, der dabei herauskommt – in keinem Verhältnis zum „Volume“. Dieser Nutzen könne an der Rate der vermeidbaren Sterbefälle gemessen werden. Als vermeidbar gelten Sterbefälle, wenn sie aufgrund präventiver Maßnahmen oder einer angemessenen Therapie hätten verhindert werden können. Zwar ist Deutschland in dieser Hinsicht etwas besser als der OECD-Schnitt, liege aber dennoch hinter vielen anderen westeuropäischen Staaten.
Hochtouriges Gesundheitssystem
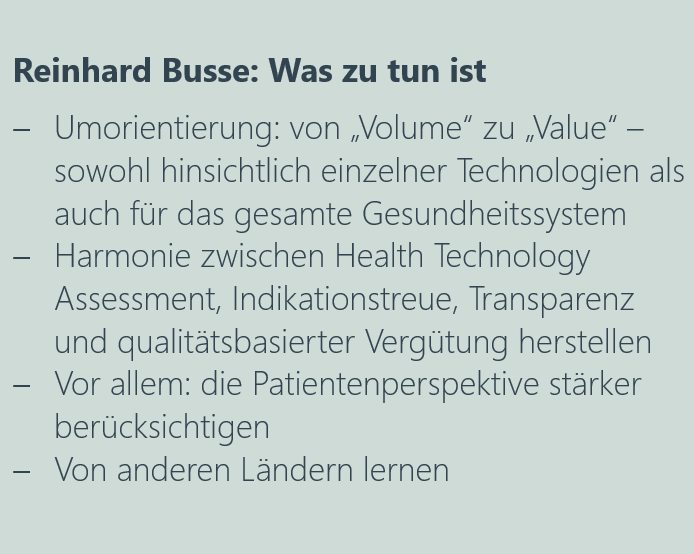
„Unser System läuft hochtourig“, konstatierte Busse. „Wir haben keine Unter-, wir haben eine Überversorgung.“ Der Gesundheitsökonom identifizierte mehrere Stellschrauben, an denen gedreht werden könnte, um das zu ändern. Da wären zunächst die Regulierungsmechanismen, die seiner Meinung nach nicht gut ineinander greifen. „Wir betreiben einen riesigen Aufwand bei der frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln“, stellte der Gesundheitsökonom fest. Aber: „Die meisten Arzneimittel, die verordnet werden, weisen zwar für bestimmte Patientengruppen einen Zusatznutzen auf, für andere jedoch nicht – werden ihnen aber dennoch verschrieben.“ Neben einem guten Health Technology Assessment müsse ganz klar im Vordergrund stehen, dass medizinische Leistungen nur dann erfolgen, wenn sie angebracht sind. Zudem sollte viel stärker deutlich gemacht werden, welche Leistungen verzichtbar sind. Busse verwies auf die US-amerikanische Kampagne „Choosing wisely“, eine Initiative, mit der Ärzte auf medizinische Leistungen aufmerksam machen, die unnötig sind oder gar schaden. Die deutschen Leitlinien hingegen gäben vor, welche Leistungen erbracht und nicht, welche lieber weggelassen werden sollten.
Vergütung auf neue Datengrundlage stellen – und Patientenperspektive miteinbeziehen
Busse sparte auch nicht mit Kritik an den Qualitätsberichten des Instituts für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG). Diese ließen die Gründe für das riesige Qualitätsgefälle zwischen einzelnen Krankenhäusern im Dunkeln. Beispiel Herzinfarkt: Es gebe Krankenhäuser, in denen die Patientinnen und Patienten innerhalb von 30 Tagen 11-mal häufiger versterben als im Durchschnitt aller anderen Krankenhäuser. Leicht zugänglich seien diese Informationen nicht. „Das ‚T‘ in IQTIG muss man deutlich hinterfragen“, so Busse. Behandlungsergebnisse müssten transparent sein.
Darüber hinaus plädierte der Wissenschaftler für ein neues Anreizsystem. Sprich: eine Vergütung, die anders als die Fallpauschalen und Einzelfallvergütung nicht mengengetrieben ist, sondern sich am Ergebnis – besser noch: am langfristigen Outcome – orientiert. Dieses könne man an Daten ablesen, die ohnehin erhoben werden, etwa die Reoperationsrate nach einem Eingriff oder die Sterblichkeit nach medizinischen Maßnahmen. „Diese Daten gibt es – wir müssen sie nur auswerten“, mahnte Busse. Außerdem müsste die Perspektive der Patienten von Anfang an in die Auswertung miteinfließen: Dafür müssten während des stationären Aufenthalts sogenannte Patient Reported Experience Measures (PREMs) und nach der Krankenhausbehandlung Patient Reported Outcome Measures (PROMs) erhoben werden. Andere Länder machen längst vor, wie das geht – nachzulesen in der Broschüre „Patient-Reported Outcome Measures (PROMs): ein internationaler Vergleich“, die die Bertelsmann Stiftung zusammen mit der Weissen Liste und der TU Berlin erarbeitet hat.
„Wir brauchen dringend eine Umorientierung hin zu mehr ‚Value‘“, plädierte Busse. Der erste Schritt, das zu erreichen, bestehe darin, die Notwendigkeit dessen anzuerkennen.
Marktzugang und Finanzierungsmechanismen neuer Technologien
Nach der Gesamtschau von Reinhard Busse auf eine Value-basierte Versorgung griff sich seine wissenschaftliche Mitarbeiterin PD Dr. Cornelia Henschke einen Teilaspekt heraus. „Welche Technologien wollen wir?“, fragte sie zu Anfang ihres Vortrags. Und lieferte die Antwort im nächsten Atemzug: Innovationen mit einem Nutzen für Patienten. Außerdem sollten sie angemessen vergütet werden, sprich: Ihr Nutzen sollte sich im Preis widerspiegeln. Keine leichte Sache. Denn das europäische Zulassungssystem, führte Cornelia Henschke aus, stelle nicht sicher, dass beim Markteintritt neuer Technologien ihre Wirksamkeit auch belegt ist – anders als bei Arzneimitteln, deren Zulassung an eine frühe Nutzenbewertung gebunden ist. Für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden gilt im stationären Sektor die „Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“ – das heißt, eine neue Technologie darf, sofern sie über eine CE-Zertifizierung verfügt, so lange zum Einsatz kommen, bis der Gemeinsame Bundesausschuss dies untersagt.
„Deshalb müssen wir nachsteuern“, stellte Cornelia Henschke fest. Das geschieht vielfach über „Coverage with Evidence Development“ (CED): Dieser Ansatz besagt, dass die Evidenz im Nachgang zur Zulassung generiert wird. In Deutschland geschieht dies über den §137 h des Sozialgesetzbuches V, in dem der Gesetzgeber die frühe Nutzenbewertung für Medizinprodukte hoher Risikoklasse verankert hat. Wenn Krankenhäuser neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) mit Hochrisikoprodukten anwenden und dafür ein NUB-Entgelt verhandeln möchten, müssen sie dem Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) Informationen über den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dieser Methode übermitteln. Auf dieser Grundlage bewertet der GBA den Nutzen bzw. das Potenzial der Methode. Sieht der GBA den Nutzen der Methode als nicht als bewiesen an, findet aber, dass sie als Behandlungsalternative in Frage kommt, müssen sich die Krankenhäuser und Hersteller an einer Erprobung des Medizinprodukts nach § 137e SGB V beteiligen. Doch bis dabei ein valides Ergebnis herauskommt, vergehen meist mehrere Jahre – Jahre, in denen die Methode ganz oder teilweise auf Kosten der GKV erstattet wird.
Erstattung und Einkauf müssen sich am „Value“ orientieren
Die Erstattungsfähigkeit beeinflusse das gesamte Gesundheitssystem, unterstrich Cornelia Henschke: das Einkaufsverhalten der Krankenhäuser ebenso wie die Therapieentscheidungen der Ärzte, die Umsätze der Medizinproduktehersteller, ihre F&E-Aktivitäten, die Kassenlage der GKV. Deshalb forderte die Gesundheitsökonomin für Technologien das Gleiche wie Reinhard Busse für die medizinische Versorgung im Allgemeinen: nämlich Outcome-Orientierung. Dafür müssten klinische und patientenrelevante Ergebnisparameter definiert und konsequent gemessen, die Behandlungskosten über den gesamten Versorgungspfad hinweg optimiert und Risiken gleichmäßig zwischen Leistungserbringern, Kostenträgern und Herstellern aufgeteilt werden. Als ein Beispiel griff Henschke Bundled Payments heraus: Dabei werden sämtliche Behandlungskosten abgedeckt, inklusive der Kosten, die aufgrund von Komplikationen oder bei der Behandlung von Mehrfacherkrankungen anfallen. Die Vergütung erfolgt risikoadjustiert, sprich je älter und kränker Patienten sind, umso mehr können medizinische Leistungen kosten, einfach weil sie langwieriger oder aufwendiger sind. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass die Behandlung gute Ergebnisse zeigt, beispielsweise eine Linderung der Schmerzen erreicht oder Körperfunktionen wieder herstellt.
Auch die Beschaffung, so Henschke, sollte Value-basiert sein. Nicht der Preis, sondern der Nutzen sowohl für die kranken Menschen als auch für das ärztliche Personal und Pflegefachkräfte müsse beim Kauf von Technologien im Vordergrund stehen. Neuen Produkten oder Geräten könne ein Nutzen bescheinigt werden, wenn sie etwa die Infektionsraten und Folgeeingriffe reduzieren, besonders anwenderfreundlich und nachhaltig sind, oder auch, wenn sie dazu beitragen, PROMs zu messen.
Neue Kriterien für Nutzenbewertung abwägen
Darüber hinaus gab die Wissenschaftlerin zu bedenken, dass die Kriterien für eine frühe Nutzenbewertung auf den Prüfstein gehören. Bislang sei sie lediglich für Hochrisikoprodukte vorgesehen. Zudem berge ihre Kopplung an das NUB-Verfahren berge die Gefahr, dass Hersteller kein NUB-Entgelt mehr beantragen, um sich eine Erprobung zu ersparen – eine teure Angelegenheit, auch wenn die GKV einen Teil der Kosten übernimmt. Auf diese Weise würde Patienten der Zugang zu Innovationen versperrt. Ein Ansatzpunkt könnte sein, wie oft eine Methode zur Anwendung kommt. Zudem sei zu überlegen, ob eine etablierte Methode weiterhin erstattet werden sollte, wenn es neue und bessere Alternativen gibt. Eine lückenlose Informationsbereitstellung sei unabdingbar: Ergebnisse von Technologiebewertungen müssten den Krankenhäusern mitgeteilt werden.
Abschließend appellierte Cornelia Henschke, dass ein Value-basiertes Gesundheitssystem nur errichtet werden könne, wenn sämtliche Akteure daran mitwirken. „Nicht nur Leistungserbringer sind gefordert, im Sinne des Patientennutzens zu handeln. Auch die Krankenkassen sind gefragt“. In diesem Sinne griffen im Anschluss an die Vorträge verschiedene Workshops das Thema aus verschiedenen Perspektiven auf: aus Sicht der Leistungserbringer, der Sozialleistungsträger und Versicherungen und aus Sicht der Patienten. Ein Workshop beschäftigte sich außerdem mit „Integrierten Systemen“.
Workshop 1 – Leistungserbringer
Es gibt wohl kaum ein Krankenhaus, das sich in seinem Leitbild nicht dazu bekennt, die Patienten in den Mittelpunkt stellen zu wollen. Doch bei vielen Krankenhäusern klaffen Anspruch und Wirklichkeit meilenweit auseinander. Für die Martini-Klinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist dieser Anspruch allerdings mehr als eine leere Worthülse. Ihr Geschäftsführer Dr. Detlef Loppow stellte das „Martini-Prinzip“ vor, das im Wesentlichen auf drei Säulen beruht: Spezialisierung, flache Hierarchien, Erfassen von Behandlungsergebnissen auch nach der Entlassung. Dafür arbeitet die Klinik mit PROMs des ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement). „Damit kann jedes Krankenhaus sofort loslegen“, betonte Loppow. Der Erfolg der Martini-Klinik spricht jedenfalls Bände – das Prostatakrebszentrum des UKE ist zu einem der größten Zentren weltweit aufgestiegen.
Professorin Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK) präsentierte die Ergebnisse des Projektes „Innovative Versorgung von akut erkrankten Bewohnern und Bewohnerinnen im Altenheim“ der Universität Witten/Herdecke. Ausschlaggebend für die Studie war die Fragestellung, warum es Pflegeheimbewohnern nach einem stationären Aufenthalt oftmals so viel schlechter geht als davor. Zwei Jahre lang untersuchten die Wissenschaftler, wie Krankenhauseinweisungen vermieden werden könnten. Sie entwickelten ein 6-Phasen-Modell mit Maßnahmen, um Krankenhauseinweisungen vorzubeugen. Außerdem identifizierten sie 58 Diagnosen, mit denen alte Menschen im Heim besser aufgehoben sind als im Krankenhaus. Das spart nicht nur dem Gesundheitssystem viele Kosten – vor allem erspart es betagten Menschen unnötige Krankenhausaufenthalte.
Professor Dr. Andreas Beivers von der Hochschule Fresenius griff in seinem Vortrag ein brandaktuelles Thema auf: Nicht erst seit den Koalitionsverhandlungen wird die Abschaffung des DRG-Systems gefordert. Beivers präsentierte sektorenübergreifende Regionalbudgets als Alternative. Festgelegt für definierte Regionen mit etwa 200.000 bis 400.000 Einwohnern, würden diese Regionalbudgets möglichst viele Gesundheitsleistungen umfassen – bei klar definierten Qualitätsstandards und messbaren Ergebnisparametern. Die Leistungserbringer würden eigenständig entscheiden, wie sie ihr Budget einsetzen und welche Leistungen sie ambulant oder stationär erbringen würden. Die Menschen könnten ihren Arzt frei wählen und auch Mediziner aus anderen Regionen aufsuchen. Das befeuere einerseits den Wettbewerb zwischen den Regionen, könne sich anderseits aber auch positiv auf regionale Kooperationen auswirken. Wird das DRG-System beibehalten, so Beivers, bräuchte es einen neuen ordnungspolitischen Rahmen. Nicht zum ersten Mal an diesem Tag hieß es: „Wir müssen weg von der Mengensteuerung, hin zu mehr Qualität“. Damitschloss sich der Gesundheitsökonom seinen Vorrednern an.
Workshop 2 – Integrierte Systeme
Im Workshop 2 ging es um integrierte Systeme. Es wurden unterschiedliche Ansätze auf Indikationsebene, internationale Best Practices genauso wie Konzepte im Kontext der digitalen Integration vorgestellt und diskutiert. Professor Dr. Martin Härter, Institutsdirektor des Zentrums für Psychosoziale Medizin am UKE, berichtete zu den Erfahrungen in der Implementierung von Stepped and Collaborative Care-Ansätzen in Mental Health. Dr. Benedikt Simon, der zurzeit im Rahmen eines Harkness Fellowship in Healthcare Policy and Practice des Commonwealth Fund in den USA integrierte Versorgungssysteme untersucht, zeigte im Anschluss, wie das US-amerikanische Unternehmen Kaiser Permanente und verschiedene Gesundheitseinrichtungen mithilfe alternativer Vergütungssysteme erreicht haben, die Gesundheitsversorgung zu optimieren und von „Volume“ in Richtung „Value“ gedreht haben. Ausschlaggebend war dabei auch, dass sie Versorgungsdaten ausgewertet und so für die Verbesserung der Versorgung genutzt haben.
Anja Burmann vom Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik (ISST) stellte die IT-Anforderungen für ein Population Health-Management und dessen Erfolgsmessung vor. Dafür sei eine integrierte Nutzung von zeitnahen „Real-World“-Versorgungsdaten verstärkt erforderlich. Gleichzeitig müsse es einen Wandel im organisatorischen Denken geben: Um medizinische Leistungen sektorenübergreifend im Sinne eines ganzheitlichen Patientennutzens erbringen zu können, müsste oberhalb der Sektoren eine koordinierende Stelle geschaffen werden, die auch finanzielle Anreize setze.
Workshop 3 – Sozialleistungsträger/Versicherungen
Dr. Helmut Hildebrandt, Vorstandsvorsitzender der OptiMedis AG, sprach darüber, wie Krankenkassen hinsichtlich des Outcomes verglichen werden könnten. Gemäß §1 SGB V ist die Krankenversicherung gesetzlich dazu verpflichtet, sich um die Gesundheit der Versicherten zu kümmern. Für das Ergebnis medizinischer Behandlungen wird sie jedoch kaum zur Verantwortung gezogen. Außerdem stehe die Anreizstruktur für Krankenkassen einer Verbesserung des Gesundheitsstatus‘ der Versicherten teilweise entgegen. Dabei hätten Krankenkassen durchaus mehr Möglichkeiten, die Gesundheit ihrer Versicherten positiv zu beeinflussen und sich damit von ihren Wettbewerbern zu unterscheiden, sei es, indem sie die Gesundheitskompetenz ihrer Versicherten stärken oder Verträge mit Leistungserbringern bzw. Systemen ergebnisorientiert ausgestalten. Morbiditätsbezogene Ergebnisindikatoren, etwa später einsetzende Chronifizierung, Dialysepflicht oder Pflegebedürftigkeit, sowie internationale Indikatoren, welche die Versichertenperspektive abbilden, könnten den Wettbewerb positiv befeuern. Dies sei auf der Basis vorhandener Daten schon heute möglich.
Servicequalität und Transparenzanforderungen an Krankenkassen war das Thema von Thomas Müller, dem stellvertretenden Geschäftsführer Markt/Produkte des AOK-Bundesverbands. Mit einer besseren Transparenz über das Leistungsgeschehen könnten die Krankenkassen einen wichtigen Beitrag zum Verbraucherschutz und zur Stärkung der Gesundheitskompetenz von Versicherten leisten. Wesentlicher Erfolgsfaktor für die Akzeptanz von Transparenzberichten ist laut Müller ein guter Mix von aussagekräftigen Transparenzparametern und ein ausgewogenes Verhältnis von Informationsumfang und -tiefe. Die AOK veröffentliche bislang Antragsbearbeitungsfristen und Informationen zu Kassen- und Satzungsleistungen. Kritisch wurde diskutiert, dass es keinen gesetzlichen Rahmen gibt, in dem die Anforderungen und Standards für Qualitätsindikatoren abgesteckt werden. Dies erschwere es den Versicherten, das Outcome von Leistungserbringern zu beurteilen und informierte Entscheidungen zu treffen.
Dr. Hajo Schmidt-Traub, stellvertretender Ärztlicher Direktor des Unfallkrankenhauses Berlin (UKB), sprach über Ergebnisqualität im Kontext der BG-Kliniken. Das BG-System mit seiner übergreifenden Logik aus Renten-, Kranken- und Unfallversicherung mache es moralisch und rational sinnvoll, Maßnahmen zu finanzieren und zu erstatten, die in der GKV kaum möglich seien. Beispielsweise habe die BG Bau die Ausstattung von Baggern mit Rückfahrkameras finanziert, da so schwere oder tödliche Unfälle auf Baustellen verhindert werden. Es gelte das Prinzip: Reha first. Verrentungen oder Entschädigungszahlungen sollten erst in Betracht gezogen werden, wenn sämtliche mögliche Reha-Maßnahmen ausgeschöpft sind. Erfolgsaussichten werden über eine sogenannte Heilverfahrenssteuerung (Case Management) mithilfe klarer Kriterien systematisch beurteilt. In diese Betrachtung fließt auch mit ein, ob ein Patient willens und in der Lage ist, Reha-Maßnahmen zu absolvieren. In der anschließenden Diskussion wurde es als sinnvoll angesehen zu prüfen, wie mithilfe von Kooperationen von Sozialversicherungsträgern der anderen Sozialgesetzbücher die Anreize im SGB V besser auf das Outcome ausgerichtet werden können.
Workshop 4 – Patientenerfahrungen
Im Workshop „Patientenerfahrungen“ wurde diskutiert, wie das Thema Patientenerfahrungen mehr in die Versorgung eingebunden werden kann. Eine standardisierte Erfassung von Patientenerfahrungen (Patient-reported Experiences, PREMs) und Patientenergebnissen (Patient-reported outcomes, PROMs) die sich an internationalen Beispielen wie der „GP Patient Survey“ und dem NHS-Programm „Patient Choice“ in England orientieren, spielten dabei eine wesentliche Rolle, wie Dr. Oliver Gröne, für Research und Analytik verantwortlicher Vorstand von OptiMedis, betonte. PROMS und PREMS müssen in den Versorgungsprozess einbezogen und transparent dargestellt werden, um die Versorgungsqualität zu optimieren und individualisieren.
Irina Cichon von der Robert Bosch Stiftung stellte die Ergebnisse der Bürgerdialoge aus der Neustart!-Initiative vor. Daraus wird ersichtlich, dass sich Menschen ein solidarisches und am Gemeinwohl orientiertes Gesundheitssystem mit mehr Partizipation, Mitbestimmung, Transparenz, Personal und Zeit für Aufklärung wünschen. Ein Anfang könne sein, die Bürgerinnen und Bürger in kommunale Gesundheitskonferenzen einzubeziehen. Auch Dr. Ilona Köster-Steinebach betonte in ihrem Vortrag, dass eine qualitativ hochwertige Erfassung von Patientenerfahrungen zentral dafür sei, dass das Gesundheitswesen Menschen dabei unterstützt, gesund zu bleiben bzw. zu werden, mit Krankheiten bestmöglich zu leben und in Würde zu sterben. Leider sei es mit den derzeitigen Vergütungsanreizen schwierig, den Patientennutzen in den Vordergrund zu stellen. Die Patientenerfahrung stärker in die Versorgung einzubeziehen, bleibe eine politische Entscheidung.
Jana Ehrhardt-Joswig
Freie Journalistin
Präsentationen der Referenten
Prof. Dr. rer. pol. Andreas Beivers, Professor für Volkswirtschaftslehre und Studiendekan für Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fresenius in München, Leitung wissenschaftliche Projekte Stiftung Münch
„Wie verändern Vergütungssysteme, die auf Ergebnismessung beruhen, die Orientierung von Leistungserbringern? Regionalsbudgets statt DRG und Einzelleistungsvergütung“
Prof. Dr. h.c. Christel Bienstein, Pflegewissenschaftlerin Universität Witten-Herdecke, Präsidentin DBfK / Prof. Dr. Sabine Bohnet-Joschko, Lehrstuhl für Management und Innovation im Gesundheitswesen, Universität Witten/Herdecke
„Die Senkung der Anzahl vermeidbarer Krankenhausfälle als Ergebnis von Pflegequalität“
Anja Burmann, Digitalization in HealthCare Wissenschaftlerin Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST
„IT Anforderungen für Population Health Managemen und Measurement“
Prof. Dr. med. Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen an der Fakultät Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin
„Von einem „volume“- hin zu einem „value“-basierten Gesundheitssystem – eine internationale Perspektive
Irina Cichon, Senior Projektmanagerin Themenbereich Gesundheit, Robert Bosch Stiftung, Projektleiterin „Neustart!“
„Anforderungen von Bürgerinnen / Patientinnen an Ergebnisse des Gesundheitssystems. Erfahrungen aus der Neustart!-Initiative“
Dr. Oliver Gröne, stellv. Vorstandsvorsitzender OptiMedis
„Nothing about me without me – Patient Reported Experiences (PREMs) und Patient Reported Outcomes (PROMs)“
Dr. Cornelia Henschke, Leiterin Projektbereich Gesundheitsökonomie des Fachgebietes Management im Gesundheitswesen an der Technischen Universität Berlin
„Der Umgang mit (innovativen) Technologien in einem „value“-basierten Gesundheitssystem?“
Dr. h.c. Helmut Hildebrandt, Vorstandsvorsitzender OptiMedis
„Optionen für einen Vergleich von Krankenkassen nach Outcome“
Dr. Detlef Loppow, Geschäftsführer Martini-Klinik, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
„Ergebnisse zählen: Erfahrungen mit Value Based Health Care in der Umsetzung durch die Martini-Klinik in Hamburg“
Thomas Müller, stellv. Geschäftsführer, Geschäftsführungseinheit Markt/Produkte, AOK-Bundesverband
„Servicequalität und Transparenzanforderungen an Krankenkassen“
Dr. Benedikt Simon, Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice des Commonwealth-Fund
„Verhältnis von Qualitätsverbesserung und Cost-Savings in Integrated Systems (Erfahrungen mit „Alternative Payment Systems“ in den USA)“